Psychisch wirksame Lenkung der Aufmerksamkeit durch Arbeitsmittel
Von Hexenbesen, Peitschen und Zügeln
Knut hat die Aufgabe, Additions- und Subtraktionsaufgaben in zufälliger Anordnung zu bearbeiten. Das fällt ihm ungeheuer schwer. Hat er einmal mit der Addition begonnen, so addiert er auch dann weiter, wenn eine Subtraktion gefordert ist. Umgekehrt passiert es ihm genauso. Er arbeitet nach dem Motto: Einmal Minus immer Minus, egal was in der Aufgabenstellung angegeben ist. Soll er die Aufgabe 3 + 7 im Anschluss an ein oder zwei Subtraktionsaufgaben rechnen, so erscheint in seinem Kopf vermutlich 3 – 7. Auch ihm als Grundschüler müsste doch auffallen, dass er diese Aufgabe mit den Algorithmen, die ihm zur Verfügung stehen, nicht rechnen kann. Weit gefehlt! Knut scheint zwar irgendwie die Unwahrscheinlichkeit der Aufgabe registriert zu haben, aber er geht dem, was er registriert hat, nicht nach, indem er überlegt, was an der Aufgabe merkwürdig ist und wie diese Merkwürdigkeit wohl zustande gekommen sein könnte. Knut handelt, je flinker desto lieber. Er vertauscht rasch die Zahlen: Aus 3 – 7 wird 7 – 3. Das kommt ihm ohnehin gelegen, da so der Subtrahend kleiner wird und es sich leichter rechnen lässt als mit einem großen Subtrahenden.
Obwohl wir uns ein wenig darüber amüsieren, dass es in seinem Kopf einfach keinen „Schalter“ zu geben scheint, der sich von selbst einschaltet, wenn die Aufgabenart wechselt, ist klar, dass er in der Schule ohne einen solchen Schalter nicht auskommt.
Knut ist der Meinung, in seinem Kopf ist ein solcher Schalter vorhanden, er hat sich nur verhakt. Vielleicht können wir mit etwas Schütteln nachhelfen, damit sich die Verhakung löst?
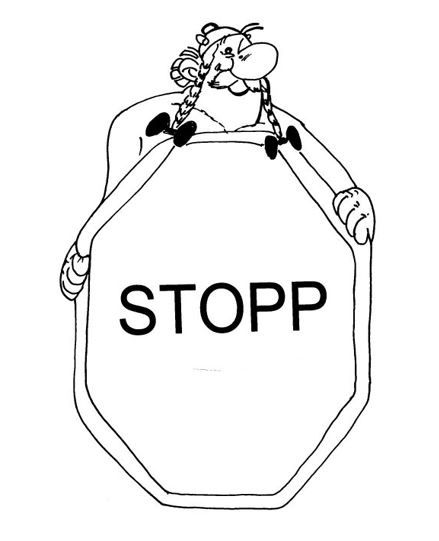
Ich angele ein von einem Obelix getragenes STOPP-Schild aus meinem Ordner. Knut schaut sich das neue Arbeitsmittel interessiert an. Das also soll Schütteln bewirken? Er ist überaus skeptisch. Vielleicht muss der Schalter nicht geschüttelt werden, damit sich der Haken löst. Vielleicht muss man dagegen klopfen? Oder einen Schieber einbauen? Knut will es mal mit einem Schieber ausprobieren. Ja, ich soll das STOPP-Schild immer dann zeigen, wenn die Aufgabenart wechselt. Aber viel mehr als das STOPP interessiert ihn der Obelix. Er findet ihn sehr lustig.
Ich mache Knut darauf aufmerksam, dass der Obelix ein großes STOPP trägt. Das STOPP ist wichtig fürs Lernen. Allerdings wirkt ein STOPP erst dann wie ein Schieber speziell für Knut, wenn Knut sich mit dem Schieber vertraut gemacht hat. Es muss Knuts Schieber werden, ansonsten bleibt das STOPP meistens wirkungslos. Das kann Knut einzusehen und er greift meine Anregung, das Wort STOPP anzumalen, gerne auf. Er soll das Wort in knalligen, grellen Farben ausmalen, in Farben, die einem förmlich ins Auge springen. Vielleicht wird das Wort STOPP auf diesem Wege zu Knuts Schieber. Den Obelix will Knut aber auch anmalen, der hat es ihm angetan.
Knut malt schnell und nicht sonderlich genau, aber mit der Farbenwahl gibt er sich sichtlich Mühe. Immer wieder fragt er mich, ob die gewählte Farbe auch grell genug sei, ob sie so richtig knallig sei. Man spürt, wie ihm das Wort über die Lippen knallt.
Das Malen scheint ihm zu gefallen. Ich erlebe erstmals, dass er sich in eine Sache vertieft. Wir nehmen uns viel Zeit für die Ausführung dieser Aufgabe. Am Ende ist Knut sehr zufrieden mit seinem Malergebnis.
Er hat lange an einem Stück gearbeitet. Seine Aufmerksamkeit war ganz auf die Farbenwahl und das Ausmalen gerichtet. Knut hat sich nicht ablenken lassen. Weder hat er sich durch fremde Geräusche irritieren lassen, noch stets aufs Neue festgestellt, dass man mit spitzen Stiften besser malen kann. Auch hat er sich nicht einmal mit übergründlichem, wiederholtem Anspitzen vom konzentrierten Malen abgehalten. Das ist ein Fortschritt für Knut, über den wir uns gemeinsam freuen.
Dennoch bleibt etwas klar zu stellen. Ich bin skeptisch, ob die Bedeutung dieses kleinen Plakates, besonders die Bedeutung des Wortes STOPP für die Art und Weise wie Knut sein Lernen handhaben soll, über das Anmalen ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit gerückt werden konnte. Er hat sich sehr intensiv mit dem Malen und mit dem Obelix befasst. Das hat ihm das kleine Plakat nahe gebracht. Aus dem Plakat ist Knut selbst gestiegen, er hat sich mit dem, was er tat, sehr ernst genommen, hat sein Malen ein Stück weit durchlebt. Ich bezweifle jedoch, ob diese Bewegung, die in Knut ausgelöst werden konnte, auch das Wörtchen STOPP einschließt, um das es schließlich geht.
Ich hake nach, um sicher zu stellen, dass er auch das STOPP und das, was es mit diesem kleinen Wort, auf sich hat, in sich aufnimmt. Nachdrücklich versuche ich ihn nochmals auf die Bedeutung des Plakates und vor allem des Wortes STOPP für seine Arbeit anzusprechen.
Relativ schnell können wir uns darauf einigen, dass es dumm wäre, wenn man Ergebnisse, die man sich erarbeitet hat, wieder ausradieren muss. Schließlich steckt Mühe darin, zu Ergebnissen zu kommen. Überhaupt strengt es durchaus an, diese auch aufzuschreiben. Fehler sind nichts Schlimmes, man kann etwas daraus lernen. Wenn man allerdings immerzu etwas von der eigenen Arbeit ausradieren muss, dann werden Fehler nicht nur lästig, dann können sie auch sehr unangenehm werden. Häufig muss man viel radieren, wenn man auf die zu bearbeitenden Aufgaben losstürmt, als sei eine Peitsche auf einem Hexenbesen hinter einem her.
Solche Art Vergleiche gefallen Knut. Er stellt noch einmal klar, dass er das Ausradieren hasst, tief davon überzeugt, dass er mir das erneut mit Nachdruck kundtun muss. Es ist, als müsste er sich dann selbst ausradieren. Er ist schnell einverstanden, das STOPP-Schild einzusetzen, um der Hexenbesen-Peitsche Zügel anzulegen.
Zwar kann ich nun davon ausgehen, mir Knuts Bereitschaft gesichert zu haben, dieses äußere Hilfsmittel zur Steuerung seines Verhaltens in unsere Tätigkeit einbeziehen zu können. Ich habe jedoch keinesfalls sichergestellt, dass dieses Hilfsmittel auch schon ein wirksames Mittel für Knuts Probleme in der Steuerung seines Verhaltens sein wird. Indem Knut mir signalisiert, dass der symbolische Vergleich zwischen Losstürmen, Hexenbesen und Peitsche zweifellos eine Bedeutung für ihn hat, kann lediglich davon ausgegangen werden, dass sein Interesse dafür geweckt werden konnte, dieses STOPP-Schild bei der Bearbeitung von Aufgaben einzusetzen. Wie sich später zeigt, hat er auch durchaus „verstanden“ worum es geht, wenn dieses Schild in unsere Arbeit einbezogen wird. Es ist jedoch nicht nur wichtig, dass Knuts Kopf versteht, was hilfreich für ihn sein könnte, sondern auch, dass er dieses Arbeitsmittel zu dem Zweck einsetzt, für den es gedacht ist: Als Hilfe zur Steuerung seiner impulsiven Reaktionen.
Es steht uns noch ein gutes Stück gemeinsamer Arbeit bevor, bis erreicht werden kann, dass dieses Hilfsmittel zur Regulierung seines Verhaltens nicht nur von ihm akzeptiert und verstanden wird, sondern sich als psychisch wirksam erweist.
Lerntherapie will Kindern dabei helfen, die von ihnen eingeschlagenen Wege des Aufnehmens und Verarbeitens von Informationen adäquater als bisher zu ordnen und zu strukturieren. Sie will Kinder ermutigen, neue Wege zu erproben, die bevorzugten Strategien, Probleme Lösungen zuzuführen, zu flexibilisieren und zu erweitern. Um beim Lernen Wahrnehmungsprozesse steuern zu helfen und Aufmerksamkeitsprozesse auszurichten zu unterstützen, sind Arbeitsmittel als methodische Hilfsmittel von großer Bedeutung. Arbeitsmittel haben eine annähernd vergleichbare Funktion wie Anschauungsmittel, die die Vorstellungsbildung bei der Aneignung von abstrakten Wissensbestandteilen vermitteln helfen sollen. Auch Arbeitsmittel haben die Funktion eines Vermittlers. Sie sollen als äußere Stützen dabei helfen, Handlungsprozesse zu organisieren.
Jedoch nicht jedes Arbeitsmittel ist für jedes Kind passend, auch wenn es sich um ein nachgewiesen pädagogisch wertvolles handelt. Deshalb hat sich die lerntherapeutische Unterstützung der Aufgabe zu stellen, vorhandenes pädagogisches Material didaktisch so aufzuarbeiten, dass es sich für das spezifische Lernproblem des jeweiligen Kindes als handhabbar und psychisch wirksam erweist. Das lässt sich oftmals nur durch vortastende, überprüfende und sorgfältig auswertende pädagogische Arbeit erreichen. In diesen Suchprozess kann und sollte gegebenenfalls das Kind, mit dem gearbeitet wird, einbezogen werden (vgl. dazu die Fallanalyse „Obelix und Stopp müssen sich scheiden lassen“). Natürlich sollte der Therapeut dem Kind ein umfangreiches Maß an Wissen über die Struktur und Funktionsweise von Aufmerksamkeit und über didaktische Hilfsmittel, die Lern- und Aufmerksamkeitsprozesse zu lenken in der Lage sind, voraushaben. Und er sollte dieses Wissen auch anwenden können. Aber die psychische Wirksamkeit eines Arbeitsmittels bemisst sich nicht nur an Faktoren der sachlichen Immanenz, sondern auch daran, ob es sich für den, der es anwenden soll, als persönlich wichtig zu erweisen vermag.
Das Arbeitsmittel in Form des STOPP-Schildes sollte Knut neugierig auf Lernwege machen, die ihm bisher noch nicht oder nur wenig bekannt waren. Es sollte ihn herausfordern, nach neuen Verhaltensstrategien zu suchen, die ihn darin unterstützen, sein Verhalten steuern zu lernen. Er sollte seine eigene Kreativität in die Art der Verwendung des Arbeitsmittels einbringen. Seine aktive Beteiligung an der Gestaltung der lerntherapeutischen Unterstützung sollte ihm das Arbeitsmittel nicht nur nahe bringen. Sie sollte ihm auch Möglichkeiten eröffnen, mit diesem Hilfsmittel zu handeln. Er verlässt störanfällige, aber alt vertraute Bahnen. Das kann Unsicherheiten und auch Abwehr verursachen. Je sicherer er sich seiner Möglichkeiten zu handeln ist, umso stabiler vermag er sich zu fühlen, wenn er sich Neuem zuwendet. Nur derjenige, der ein gewisses Maß an Sicherheit und Stabilität zu empfinden vermag, wird sich dem Risiko stellen, das er eingeht, wenn er seine vertrauten Bahnen verlässt. Die eigentlich pädagogische Aufgabe dieser lerntherapeutischen Unterstützung lag also darin, für Knut Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihm die notwendige Sicherheit zu gewährleisten vermochten, damit er Neugier auf ihm unbekannte Lernwege entwickeln konnte.
